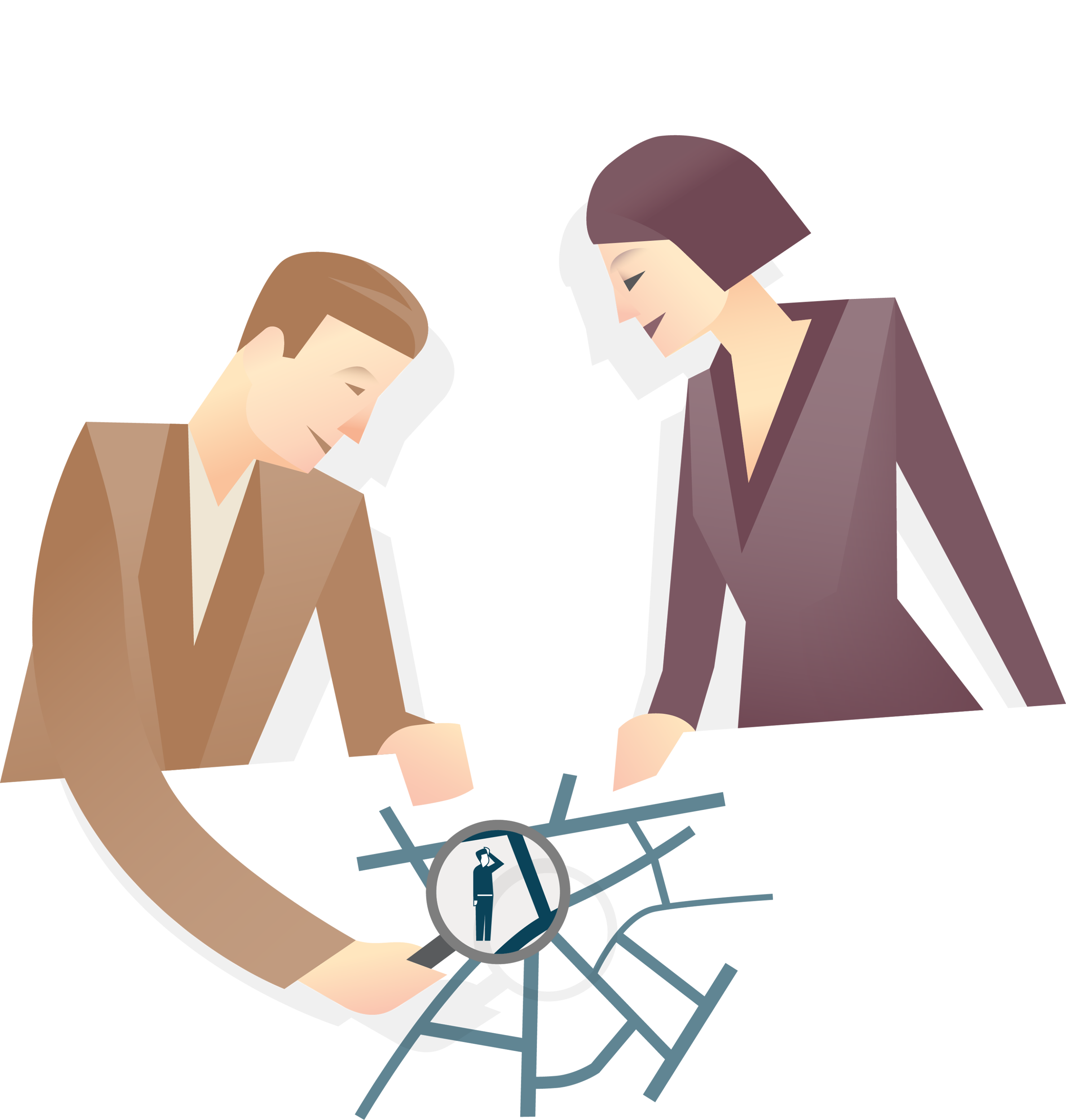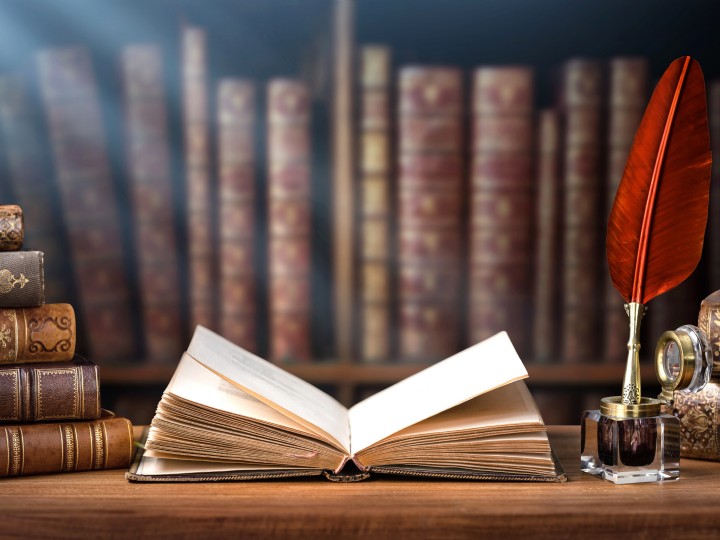Expertise trifft auf Verantwortlichkeit
Unifinanz unterstützt Sie mit Leidenschaft in Ihren Verantwortlichkeiten als privater oder institutioneller Anleger. Wir gestalten, unterstützen, überwachen und berichten rund um Ihre Vermögensanliegen. Treffen Sie unsere Kunden und erfahren Sie mehr.
Meet our clients